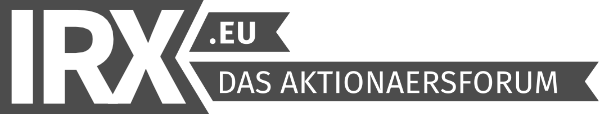Regelmäßig lässt sich an der Strombörse in Leipzig beobachten, wie der Strompreis insbesondere an windstarken Tagen gegen Null oder sogar ins Negative abrutscht: Dann ist mehr Ökostrom da, als die Deutschen selbst verbrauchen können. Damit die Netze nicht zusammenbrechen, erhalten ausländische Abnehmer Geld dafür, dass sie den überschüssigen Strom in ihre Netze leiten. Bezahlt wird die Differenz zwischen Börsenpreis und tatsächlicher Vergütung für die Anlagenbetreiber über die EEG-Umlage. Die wird von allen Stromverbrauchern aufgebracht und steigt seit Jahren – auch wegen des immer höheren „Schrottstrom“-Anteils im Netz.
Das Problem: Ließen sich früher die erzeugten Strommengen weitgehend dem tatsächlichen Bedarf anpassen, ist eine Planung von Angebot und Nachfrage aufgrund der sehr schwankenden, größtenteils tageszeit- und wetterbedingten Einspeisung durch Solar- und Windenergieanlagen nicht mehr möglich. Große Speicher, die überflüssigen Ökostrom für den späteren Verbrauch aufnehmen könnten, sind noch nicht in Sicht. Und Technologien, wie das „Power to Gas“-Verfahren, bei dem Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff oder Methan umgewandelt wird, sind noch auf absehbare Zeit wirtschaftlicher Irsinn.
Alle Solar- und Windenergieparks in Deutschland lieferten 2016 trotz des massiven Ausbaus der Kapazitäten zusammen lediglich 12,6 Prozent der benötigten Energie. Wegen der sehr volatilen Erzeugung sind alle über das zentrale Stromnetz versorgten Abnehmer weiterhin auf Energie aus herkömmlichen Kraftwerken als „Reserveenergie“ angewiesen. Die Sonne scheint nicht immer, Wind weht auch nicht überall rund um die Uhr. Solar- und Windparks sind schlicht nicht „grundlastfähig“. Zum großen Teil garantieren gerade die Atommeiler und die Kohle- und Gaskraftwerke von RWE daher weiterhin die Versorgungssicherheit. Auf der anderen Seite sind sie politisch nicht gewünscht. Ein Dilemma, dessen Lösung die Politik dem Versorger selbst überlässt.
RWE fährt derweil zweigleisig: Während der Traditionskonzern weiterhin das konventionelle Kraftwerksgeschäft verwaltet, soll die im April 2016 gestartete Tochter Innogy mit Erneuerbaren Energien ihr Geld verdienen. Das läuft dank der noch üppigen Vergütungen über die EEG-Umlage tatsächlich gut – und lässt auch den Mutterkonzern, der immerhin 75 Prozent der Anteile an Innogy hält – auf bessere Zeiten hoffen. Nach dem Rekordverlust 2016 visiert RWE im laufenden Geschäftsjahr ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,0 und 1,3 Milliarden Euro an.
Energiewende war keine Überraschung
Bei aller Freude darüber, dass bei Innogy die Geschäfte gut anlaufen, fragen viele RWE-Aktionäre mit Recht: Warum profitiert der Versorger eigentlich erst jetzt von der Energiewende? Hat RWE zu lange am alten Geschäftsmodell festgehalten und die Energiewende regelrecht verschlafen? Schließlich bedroht die Energiewende zwar seit dem 2011 vorgezogenen Atomausstieg massiv die Art und Weise, wie RWE jahrzehntelang Geld verdient hat. Im Grunde läuft die Energiewende in Deutschland aber mindestens seit den 1990er Jahren. Seit dem Jahr 2000 gibt es das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das den Ausbau der Kapazitäten von Ökostrom fördert. Aber statt in neue Technologien zu investieren und von dem Wandel zu profitieren, hat sich RWE lange Zeit einzig darauf konzentriert, die eigenen Pfründe zu sichern.
Jetzt also der Wandel: Innogy soll neue Einnahmequellen im grünen Sektor erschließen, RWE das konventionelle Energiegeschäft durch ein verbessertes Tradinggeschäft erweitern. Doch die Vergütungen für Ökostrom sinken immer stärker, auch bei den garantierten Netzrenditen stehen 2018 Kürzungen an. Die Bäume wachsen auch bei Innogy nicht in den Himmel. Die RWE-Tochter muss mit Innovationen punkten, um sich in einem umkämpften Zukunftsmarkt behaupten zu können. Viele neue Entwicklungen, von denen Innogy profitieren möchte, sind aber noch nicht marktreif. Andere, wie etwa die Ladesäule für Elektroautos, haben sich bislang nicht durchgesetzt. Keine Frage: RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz wird auf der Hauptversammlung am 27. April Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aktionäre und Analysten möchten wissen, wie die Zukunft für den Essener Traditionskonzern aussehen soll.
Mit großem Interesse werden auch zahlreiche Kommunen im Ruhrgebiet die Hauptversammlung verfolgen. Immerhin halten die Städte 24 Prozent an RWE und fordern eine rasche Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen. Liefert Schmitz nicht, droht der Ausstieg der Großaktionäre. RWE-Chef Schmitz weckte bereits Hoffnungen auf die Rückkehr einer Dividende: Für 2017 sollen wieder 50 Cent pro Aktie fließen. Ob der Konzern das Niveau langfristig halten oder sogar steigern kann, steht aber in den Sternen.