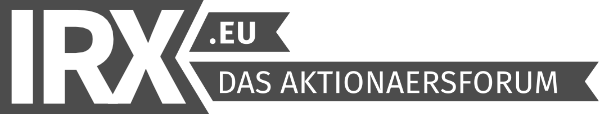Die Zeiten, in denen Hauptversammlungen der Deutschen Bank Sternstunden teutonischer Aktionärsdemokratie waren und die Leistungen von Vorständen und Aufsichtsräten mit dem Etikett „vorbildlich“ versehen als Best-Practice-Case für Hochschulen taugten, gehören bedauerlicherweise der Vergangenheit an. Gewiss, bei dem Abschied von Josef Meinhard Ackermann im Mai 2012, gab es von den anwesenden 7000 Aktionären Standing Ovations für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden. Der hatte zuvor in seiner Abschiedsrede noch darauf hingewiesen, dass die Deutsche Bank unter seiner Führung ein „global wettbewerbsfähiges, hochprofitables“ Geldhaus geworden sei und „für die Zukunft gut gerüstet“.
Heute wissen wir es besser. Die Deutsche Bank hat Jahre gebraucht, dazu Unsummen von Geld, und sie hat etliche Vorstände und Aufsichtsräte verschlissen, um Ackermanns Nachlass halbwegs zu überstehen. Hätten ihre Vorderleute, allen voran Oberaufseher Paul Achleitner, die Aufräumarbeiten besser, schneller und effektiver erledigen können? Womöglich schon. Aber nach vier Kapitalerhöhungen in sieben Jahren mit einem Volumen von mehr als 20 Milliarden Euro wird die Vergangenheitsbewältigung langsam eher ein Thema für Wirtschaftshistoriker.
Die Aktionäre – optimistisch, wie sie sind, sonst wären sie ja nicht Aktionäre, sondern „short“ gegangen – setzen darauf, dass bei der Hauptversammlung am 18. Mai in der Frankfurter Festhalle der Startschuss in eine bessere Zukunft erfolgt. Und die Entwicklung der Aktie nährt diesen Optimismus, zumindest ein wenig. Ihr Tief von gut zehn Euro Ende September 2016 hat das Papier offenbar überwunden, aktuell notiert sie bei um die 15 Euro. Wichtiger aber als der Kurs sind die Kurstreiber.
Dazu gehört nicht zuletzt der Einstieg des neuen Großaktionärs HNA aus China. Man darf getrost davon ausgehen, dass die Troika aus HNA (knapp fünf Prozent Aktienanteil) und den weiteren Großaktionären aus Katar (gut sechs Prozent) und dem amerikanischen Vermögensverwalter-Primus Blackrock (gut fünf Prozent) einige Dynamik entfalten wird, denn keiner von ihnen ist dafür bekannt, Verlustzuweisungen als Bestandteil seines Geschäftsmodells zu begreifen. Philipp Hildebrand, Vice-Chairman bei Blackrock und Mitglied des Global Executive Committee beim größten Vermögensverwalter der Welt, hat Ende März in einem aufsehenerregenden Interview in der „Zeit“ die Richtung vorgegeben: Ausgerechnet den italienischen Unicredit hat er als Vorbild gelobt, weil die Bank nicht nur ihr Kapital erhöht habe, „sondern parallel auch ihr Geschäftsmodell radikal ändert“. Die Deutsche Bank dagegen hat bisher nur das Kapital erhöht, ihr Geschäftsmodell, so Hildebrand, sei „aber nach wie vor sehr komplex“.
Das Außergewöhnliche an Hildebrands Aussage ist weniger der Inhalt. So oder so ähnlich denken und reden viele aus der Financial Community über die Deutsche Bank. Dass aber ausgerechnet ein Blackrock-Offizieller, noch dazu ein hochrangiger, öffentlich derartiges über ein eigenes Investment sagt, gilt als eine Art letzte Warnung an die amtierende Führung des Instituts.
Für die Aktionäre kann man nur hoffen, dass die Signale in den oberen Geschossen der beiden Türme an der Frankfurter Taunusanlage angekommen sind – und auch verstanden wurden. Sicherheitshalber haben einige Aktionäre zur Hauptversammlung ein paar Gegenanträge eingereicht, die dafür sorgen sollen, dass Vorstand und Aufsichtsrat sich mit ihrer Performance des vergangenen Jahres auseinandersetzen. Sie beantragen, dass die HV den Vorständen und Aufsichtsräten die Entlastung verweigern möge. Soweit, so üblich. Beachtung sollten aber die Begründungen finden, etwa die von Aktionär Jens Kuhn: „Wohin man bei der Deutschen Bank schaut, alles versinkt in konfusem Agieren, Inkohärenz beschreibt das Handeln. Das hin und her mit der Postbank scheint die Blaupause für das Handeln des Managements zu sein, wenn es sich ausnahmsweise einmal nicht im Kreis drehen kann.“
So wortgewaltig vermochte nicht einmal Großaktionär Hildebrand seine Kritik zu formulieren.