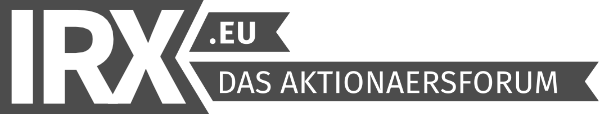Es schien ein ehernes Gesetz zu sein: An die Spitze einer Bank kommen nur die Glamour-Burschen. Jene ehemaligen Edel-Banker, die riesige Firmen an die Börse bringen oder Übernahmen mit listigen Transaktionen im Auftrag ihrer Geldgeber stemmen. Doch plötzlich haben auch andere eine Chance: Der neue JP Morgan-Chef kommt aus dem Consumer Banking, der Neue an der Spitze von Credit Suisse aus der Versicherungssparte.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Straffere Regulierung, milliardenschwere Strafen, höhere Kapitalauflagen, niedrige Zinsen und ein erbarmungsloser Margendruck im Investmentbanking. Verschärft wird die Lage durch aufsehenerregende Cyberattacken und Investmentskandale wie der des als „London Whale" bezeichneten Händlers von JP Morgan Chase, der bis März 2012 mindestens 6,2 Milliarden Dollar seiner Bank verzockte.
Die Wende in der Branche ist so fulminant, dass die Zeitschrift Forbes in der jüngsten Ausgabe so etwas wie einen Grabgesang anstimmt: „Die Investmentbanker haben einst die Welt beherrscht", heißt es dort, „aber jetzt muss JP Morgan-Chef Jamie Dimon den Investoren erklären, warum die Bank überhaupt noch in diesem Segment Geschäfte macht."
Im Auftaktquartal 2015 sind die Gebühreneinnahmen der Investmentbanken weltweit um 8 Prozent gefallen. Das Geschäft mit Börsengängen ist sogar um 36 Prozent eingebrochen. Von Januar bis März erlebten die Investmentbanken den schwächsten Start ins Jahr seit 2012.
Für JP Morgan und die anderen US-Investmentbanken spricht allerdings, dass zumindest die Geschäfte im Heimatmarkt vergleichsweise gut laufen. So waren die amerikanischen Banken – zumindest im jüngsten Quartal von Januar bis März – die relativen Gewinner des Umbruchs. Das Nachsehen hingegen haben die europäischen Geldhäuser. Sie ziehen sich teilweise oder ganz aus dem Investmentbanking zurück und verlieren deutlich Marktanteile.
Der wichtigste Grund für die schwache globale Entwicklung: Schwaches Geschäft in Europa und Asien-Pazifik, berichtete vor wenigen Tagen der Datendienst Dealogic.
JP Morgan steht demnach mit einem globalen Marktanteil von 8,5 Prozent an der Spitze der Weltrangliste im Investmentbanking, gefolgt von Goldman Sachs mit 8,2 Prozent. Die Deutsche Bank rangiert an siebter Stelle mit 4,6 Prozent direkt hinter Barclays, und vor dem Rivalen Credit Suisse. Während die US-Wettbewerber zumindest ihre Position behaupten können, sieht die europäische Landschaft im Investmentbanking wie ein Steinbruch aus.
Die Standard Chartered Bank meldete im Januar den Abbau von 4000 Stellen. Bei der Royal Bank of Scotland sollen bis zu 14.000 Arbeitsplätze in Gefahr sein. Bei Barclays wird seit einem Jahr der Anleihehandel gestutzt. Und auch auf dem Kontinent grübeln die Banker über Ihre eigene Zukunft.
So leuchtet der Aufsichtsrat der Deutsche Bank verschiedene Szenarien für die künftige Strategie des größten deutschen Geldhauses aus. Die Deutsche Bank könnte, je nachdem wieviel Platz sie dem Investmentbanking künftig einräumt, , vom allgemeinen Rückzug im Investmentbanking in Europa profitieren.
In welche Richtung der laufende Transformationsprozess in der Branche laufen wird, ist nicht klar. Experten erwarten, dass am Ende der Bereinigung vielleicht nur ein halbes Dutzend große Investmentbanken übrig bleiben, drei oder vier in den USA, in Europa nur eine oder zwei. Sie alle werden vor der kniffligen Frage stehen, ob sie sich spezialisieren – zum Beispiel auf personalintensive Beratungsleistungen wie Fusionen und Übernahmen, oder ob sie massiv in eine leistungsfähige IT-Infrastruktur investieren und auf Volumen setzen, zum Beispiel im Handel mit Wertpapieren.
Forbes sieht in der geplagten Branche eine bittere Ironie am Werk. Denn das Umfeld könnte eigentlich kaum besser sein: kräftiges M&A-Geschäft, rekordhohe Aktien-Indices, adrenalingetriebene Aktivisten. Dass die Renditen trotzdem zu wünschen übrig lassen, deprimiert die Branche.
Dem Datenspezialisten FactSet zufolge hat die Verzinsung des Eigenkapitals bei den Investmentbanken seit dem Vorkrisenjahr 2007 von 21,7 auf 9,1 Prozent nachgelassen.
Ein Hungertuch ist das nicht, ein Goldesel aber ebensowenig. Dabei hat die von vielen erwartete Korrektur an den Wertpapiermärkten noch gar nicht begonnen.
Dass die üppigen Zeiten für die Investmentbanken erst einmal vorbei sind, hört man unterdessen auch bei den Headhuntern in New York. Es sei nicht mehr so einfach, Topleute zu finden, die für mehr Geld die Bank wechseln wollen. Die meisten wollten sich aus dem Finanzwesen verabschieden, sagt zum Beispiel Rik Kopelan, einer der führenden Talentjäger an der Wall Street.
Wer regelmäßig die Wirtschaftsteile der Zeitungen liest, weiß, wohin sich die Spitzenkräfte in jüngster Zeit verstärkt verabschieden: Ins Silicon Valley, wie zuletzt die Morgan Stanley-Finanzchefin Ruth Porat, die Ende April dieselbe Aufgabe bei Google übernehmen wird. Die Investmentbankerin erhält für den Wechsel fünf Millionen-Dollar-Antrittsbonus.