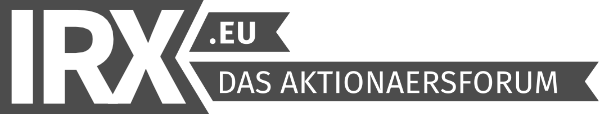Das war ein bitterer Rekord für die Daimler-Belegschaft. 167.000 Transporter der Marke Sprinter hat Mercedes zwar im Jahr 2014 im Werk in Düsseldorf-Derendorf gebaut, 25.800 davon wurden in die Vereinigten Staaten verkauft – 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor, Tendenz steigend, denn der US-Markt für kompakte Lieferwagen wächst seit Jahren schneller als anderswo in der Welt. Und der Erfolg brachte dem Werk einen Rekordumsatz.
Doch trotz hoher Umsätze und Auslastung der technologisch offenbar konzernweit führenden Düsseldorfer Daimler-Fabrik: Der Rekord hat den Daimler-Arbeitnehmern wenig gebracht. Mit der bejubelten Jahresbilanz kam die Zäsur.
Für das Jahr 2016 planen die Stuttgarter, das Werk in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt zurückzustutzen. Die Produktion des Sprinters für den nordamerikanischen Markt soll von Düsseldorf nach Charleston im US-Bundesstaat South Carolina verlagert werden.
„Durch das US-Werk wird die Belieferung des nordamerikanischen Marktes deutlich wirtschaftlicher“, sagte Volker Mornhinweg, Chef der Daimler-Sparte Vans, der Rheinischen Post im März 2015.
Eine wichtige Rolle spielte dabei ein Detail, das der Automobilmanager anführte: die US-Importzölle. Sie führen dazu, dass die in Düsseldorf für den US-Markt produzierten Sprinter aufwendig zerlegt und in den USA wieder zusammengebaut werden müssen, um genau diese Zölle wenigstens zum Teil wieder auszugleichen; sie würden die Konzernbilanz sonst mit Millionensummen belasten.
Technologieführerschaft hin, Umsatzrekorde her. Nicht zuletzt aufgrund der Zölle fallen im Düsseldorfer Daimler-Werk ab 2016 peu à peu rund 600 hochbezahlte Industriearbeitsplätze weg.
Die dezimierte Daimler-Belegschaft steht klagend für das, was Politiker Europas und Amerikas seit mehr als zwei Jahrzehnten zu reduzieren versuchen. Mittlerweile unter dem Label Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP, wird seither der Abbau von Importzöllen sowie die Angleichung von unterschiedlichen Standards und Regeln zwischen USA und EU verhandelt.
Deutschlands exportorientierte Dax-Konzerne hoffen dadurch auf bessere Geschäft, und die Hoffnung ist nicht unbegründet. Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind innerhalb des deutschen Außenhandels wirtschaftlich besonders eng mit einander verwoben.
Unter den EU-Staaten beispielsweise ist Deutschland bereits heute der mit Abstand wichtigste Handelspartner der USA, 30 Prozent aller EU-Exporte in die USA kommen nach Angaben der Europäischen Kommission aus der Bundesrepublik. Im Gegenzug sind die USA gegenwärtig Deutschlands zweitwichtigster Absatzmarkt nach der Europäischen Union.
Der deutsche Anteil der EU-Exporte ist besonders hoch in der Automobil-, Pharma- und Chemieindustrie sowie dem Maschinenbau. Allein diese Branche rechnet mit Einsparungen von bis zu 20 Prozent bei Test-, Prüf- und Zertifizierungsverfahren, sollten einheitliche Standards mit den USA eingeführt werden.
Beispiel Chemie: Die deutsche BASF ist nach eigenen Angaben in den USA nach Dow Chemical das zweitgrößte Chemieunternehmen vor Ort. Deshalb betrug der BASF-Umsatz mit Kunden in Nordamerika allein im Jahr 2014 rund 15,5 Milliarden Euro, das entsprachen knapp 21 Prozent der weltweiten Erlöse des Ludwigshafener Unternehmens.
Damit sind die Vereinigten Staaten, nach der Europäischen Union, der größte nationale Markt für die BASF. Entsprechend viel erhoffen sich die Ludwigshafener von einem leichteren Handel mit den USA. So viel, dass BASF-Chef Kurt Bock gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) „Wir wollen TTIP“ in einer Marketing-Broschüre fordert.
Trotz aller bisherigen Geschäfte mit den Vereinigten Staaten sei beispielsweise noch immer die Etikettierung von Waren ein Problem, die BASF in die USA exportiere. Zwar hätten sich die Vereinten Nationen auf ein globales Rahmenwerk zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien festgelegt, doch die Staaten hätten Spielraum bei der Gestaltung.
„Daher muss BASF beispielsweise für Exporte in die USA jedes Jahr Millionen von Labels austauschen“, sagt BASF-Chef Bock.
Ähnlich sieht das Marijn Dekkers. Nach Meinung des Bayer-Chefs würde die Annährung von Regularien die größte Erleichterung im transatlantischen Handel für das Leverkusener Dax-Schwergewicht bedeuten.
So könnten sogenannten Prüfkonzepte für klinische Studien an Kindern dies- und jenseits des Atlantiks angepasst werden. Bisher müssten die Tests trotz oft nur geringer nationaler Unterschiede im jeweils anderen Land wiederholt werden. „Das wäre nicht notwendig, würden die Prüfkonzepte im Vorfeld vereinheitlicht“, sagt Dekkers.
Auch der Darmstädter Arzneimittel- und Chemikalienhersteller Merck hofft auf Vorteile des leichteren Handels mit den USA. Denn die europäischen Tochtergesellschaften des Unternehmens etwa lieferten im Jahr 2014 Waren im Wert von 250 Millionen Euro an die US-Töchter der Darmstädter Merck. Fast so viele Waren wurden in umgekehrter Richtung transportiert.
Mit dem Freihandelsabkommen TTIP würde Merck eigenen Angaben zufolge Zollabgaben von jährlich rund sieben Millionen Euro sparen.
Freilich, gemessen an Mercks Gesamtumsatz von 11,3 Milliarden Euro im Jahr 2014 ist das nicht viel. Doch Deutschlands Wirtschaft insgesamt könnte einen Wachstumsimpuls bekommen, der sich dann auch in den Bilanzen und Aktienkursen der Dax-Unternehmen niederschlagen könnte. Denn auch der hiesige Mittelstand glaubt von TTIP zu profitieren.
Vier von fünf hiesige Mittelständler mit US-Geschäft etwa haben im August 2015 in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) angegeben, dass sie schon einmal Probleme mit der US-Zollabwicklung hatten. Mehr als 50 Prozent klagten zudem über mangelnde Transparenz der Importauflagen.
„Art und Umfang der Zolldokumente bedeuten einen erheblichen Aufwand im Handel mit den USA, der durch TTIP gemildert werden könnte”, sagte dann auch DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben dem Focus.
Dennoch bleibt der Ausmaß des TTIP-Nutzens umstritten, nicht nur für den
So gab die EU-Kommission im Vorfeld der TTIP-Verhandlungen im Jahr 2013 eine Studie beim Londoner Centre for Economic Policy Research (CEPR) in Auftrag.
Die Studie mit dem Titel „Abbau der Hindernisse für den transatlantischen Handel“ kommt zu dem Schluss, dass ein Abkommen aus Sicht der Europäischen Union jährlich rund 119 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung einbringen könnte und ein kontinuierlich höheres Wirtschaftswachstum von rund 0,5 Prozent durch ein Freihandelsabkommen möglich sei. Die EU-Kommission gilt als TTIP-Förderer.
Ganz anders liest sich eine Untersuchung der Tufts University in Massachusetts mit dem Titel „The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, Unemployment and Instability“. TTIP würde demnach in Europa rund 600.000 Arbeitsplätze kosten und, je nach Land, zu jährlichen Einkommensverlusten von 165 bis zu 5000 Euro pro Person führen. Steuereinnahmen und Bruttoinlandsprodukte der Einzelländer würden ebenfalls schrumpfen.
Diese Untersuchung aus dem Oktober 2014 schrieb die Minusentwicklung in den europäischen Krisenstaaten, wie sie bis Ende 2013 vielfach vorlag, ein ganzes Jahrzehnt fort.
Zumindest die Erfahrung deutscher Konzerne mit Freihandelsabkommen war zuletzt weit besser. Seit die EU im Jahr 2011 solch ein Abkommen beispielsweise mit Südkorea geschlossen hat, sind Deutschlands Exporte in das asiatische Land gestiegen: Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) kletterten die Ausfuhren allein im vergangenen Jahr 2014 um 8,15 Prozent.
Entsprechend wichtiger wird Südkorea für Deutschlands Exporteure: Koreas Anteil an den gesamten hiesigen Exporten ist seit 2012 von 1,22 auf 1,38 Prozent im Jahr 2014 gestiegen. „Das war nicht zuletzt auch auf den Abschluss des Freihandelsabkommens zurückzuführen“, sagt der DIHT.