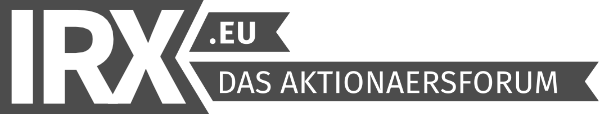Eigentlich könnten sich zwei der wichtigsten Vertreter im Porsche-Volkswagen-Prozess täglich freundlich zuwinken. Die Kanzlei Hengeler Mueller domiziliert im 98 Meter hohen Frankfurter Bürohochhaus WestendDuo, die Kanzlei Broich in der 31. Etage des 170 Meter hohen Opernturms. Beide trennen nur 400 Meter und der schlanke Rothschild-Park im Herzen der Stadt.
Und doch könnte die Distanz der beiden Wirtschaftskanzleien in diesen Tagen kaum größer sein. Denn was sind schon 400 Meter gegen 1,8 Milliarden Euro?
Um diesen Streitwert geht es seit 2011 im wohl wichtigsten zivilrechtlichen Gerichtsverfahren um die gescheiterte Übernahme Volkswagens durch Porsche. Schon jetzt steht fest: Vor allem Journalisten werden dabei auf ihre Kosten kommen. Denn schon in anderen Verfahren im Porsche-Volkswagen-Komplex flogen zwischen den Anwälten die Fetzen.
So werfen Broich & Partner, die vor den deutschen Gerichten milliardenschwere Hedgefonds um Elliott und D.E. Shaw vertreten, der Angeklagten Porsche SE, vertreten durch Hengeler Mueller, nicht weniger als "Verstöße gegen die prozessuale Wahrheitspflicht" vor. Und sie legen noch einen drauf, in dem sie der Gegenpartei „inhaltliche Koordination und Beeinflussung von Zeugenaussagen“ vorhalten.
Parallelen zum Zivilprozess zwischen Medienunternehmer Leo Kirch und der Deutschen Bank sind dabei durchaus erwünscht – schließlich vertraten die Prozessvertreter der Porsche SE auch die Deutsche Bank, deren Vorstände sich mittlerweile vor der Münchener Strafjustiz im Hinblick auf einen möglichen Prozessbetrug verantworten müssen.
Bei Hengeler Mueller stoßen solche und ähnliche Anschuldigungen indes auf Granit. Im Verfahren Porsche SE gegen die Fondsgesellschaft Glenhill bezeichnete die Kanzlei die entsprechenden Vorträge der Kläger als „Konglomerat beweisloser Mutmaßungen und Spekulationen“. Das Verfahren, dessen Streitwert bei gut 1,3 Milliarden Euro lag, wurde schließlich vom Landgericht Stuttgart abgewiesen, die Berufung scheiterte im März dieses Jahres.
In bezeichneten sich die Prozessparteien und ihre Vertreter wechselseitig als „mit unverantwortlichem Hebel agierenden Finanzinvestor“ oder als „professionelle Spekulanten“, die „hochriskante Wetten gegen den Kapitalmarkt“ eingehen und sich „gemeinschädlich“ verhalten.
Welche Polemik hier wen treffen soll, das weiß am Ende wohl keiner mehr so richtig. Schließlich steht den klagenden Hedgefonds ein Automobilkonzern gegenüber, der schon 2007 von der Wirtschaftswoche als „Hedgefonds mit Automobilproduktion“ bezeichnet wurde.
Gestritten wird nicht nur mit dem Holzhammer, sondern auch mit der Pinzette. Und zwar dann, wenn es um Definitionen und Formulierungen geht.
So legen die Porsche-Verteidiger Wert darauf, dass der Porsche-Aufsichtsrat dem Vorstand zwei Monate vor Veröffentlichung der Übernahmepläne lediglich eine „Ermächtigung“, nicht jedoch eine „Genehmigung“ zur Aufstockung der Volkswagen Beteiligung gegeben habe. Die eigentliche Entscheidung, eine 75-Prozent-Mehrheit anzustreben, sei erst am 26. Oktober 2008 gefallen.
Die Kläger glauben hingegen weniger an die Worte als an die Taten der Porsche SE. Diese habe – mit Kenntnis des Porsche-Aufsichtsrats und dessen Vorsitzenden Dr. Wolfgang Porsche – schon zwei Monate vor der öffentlichen Verkündung der Übernahmepläne durch ihre Optionsstrategien Fakten geschaffen – „Genehmigung“ oder „Ermächtigung“ hin oder her.
Mit unterschiedlichem Maß wird auch an anderer Stelle gemessen. So hatte sich der Kurs der Volkswagen-Aktie seit Mitte Oktober 2008 innerhalb von zehn Tagen von rund 400 Euro auf rund 210 Euro so gut wie halbiert – und die Kursziele der Analysten lagen zwischen 70 und 140 Euro.
Die Kläger gehen daher davon aus, dass Porsche angesichts eines drohenden weiteren Kursverfalls praktisch gezwungen war, durch die die Volkswagen-Aktie zu stützen und die Leerverkäufer so zu einem Schließen ihrer Positionen zu bewegen. Da sonst Put-Optionen hätten bedient werden müssen, was Porsche aus Sicht der Kläger finanziell überfordert hätte.
Die Porsche-Verteidiger sehen das ganz anders. Am 24. Oktober habe der Kurs bei 210,85 Euro geschlossen. „Das ist auf das Jahr gesehen ein nachhaltiger, aufwärts deutender Trend“, heißt es in einem Schriftsatz Hengeler Muellers aus dem Dezember 2012. Einen Verfall habe es nicht gegeben. „Dass die Ausübungspreise der von der Beklagten verkauften Put-Optionen angesichts eines um mehr als 60 Euro darüber liegenden Börsenkurses erreicht oder unterschritten würden, war objektiv und aus der Sicht des Vorstands der Beklagten am 26. Oktober 2008 äußerst unwahrscheinlich“, so die Verteidiger.
Dass ein von Porsche selbst in Auftrag gegebenes Gutachten des Tübinger Rechtswissenschaftlers Joachim Vogel schon im Herbst 2009 zu dem Schluss gekommen war, der Börsenkurs der VW-Aktie sei „dramatisch – von etwas unter 400,- auf etwas über 200,- € − gefallen“, macht die Arbeit für die Richter nicht einfacher.
Doch nicht nur Polemik und Dialektik haben die Beteiligten zur Meisterschaft erhoben. Auch beim Tricksen und Taktieren wird längst nicht mehr nur mit Haken und Ösen gekämpft, sondern – juristisch gesehen – auch gerne mal ein Torpedo gezündet.
Absender dieses rechtlichen Großgeschützes war am 7. Juni 2012 die Porsche SE. Der Konzern wollte damit einen seiner vielen Schadensersatzkläger, den Hedgefonds Pendragon, wenn nicht versenken, dann doch zumindest gefechtsuntauglich schießen.
Der Hintergrund: Pendragon wirft Porsche vor, die Kurskapriolen im Oktober 2008 bewusst verursacht zu haben. Ein Versuch, außergerichtlich Schadensersatzansprüche in Höhe von 195 Millionen Dollar bei den Stuttgartern geltend zu machen, scheiterte jedoch. Weshalb Pendragon am 18. Juni 2012 eine Klage beim Commercial Court in London einreichte.
Die Porsche SE war der Klägerin jedoch elf Tage zuvorgekommen. Indem sie bereits am 7. Juni 2012 eine so genannte negative Feststellungsklage erhoben hatte, sicherte sie sich die Zuständigkeit des heimischen Landgerichts Stuttgart. Dort will das Unternehmen klären lassen, ob überhaupt ein Anspruch auf Schadensersatz besteht.
Das eigentliche Ziel dieser so genannten Torpedoklage war es aber wohl, vermuten Prozessbeteiligte, einen Zivilprozess vor einem englischen Gericht zu vermeiden. Denn dort wäre ein „disclosure of documents“ möglich gewesen, wobei Porsche sämtliche für den Fall relevanten Unterlagen, Emails, Mitschriften und Mitschnitte hätte offenlegen müssen. So hätten dann auch andere Kläger Zugriff auf die sensiblen Dokumente gehabt.
Die Pendragon-Anwälte waren wenig amüsiert über den Kniff der Porsche-Verteidiger – und starteten zum Gegenangriff. Dieser war möglich geworden, weil Pendragon rechtlich nicht in Großbritannien sitzt, wo die Mitarbeiter ihre Büros haben, sondern auf den Cayman Islands, wo die Steuern niedrig sind.
Die an den dortigen Firmenbriefkasten versendete Klageschrift der Porsche SE wurde von der Post der Cayman Islands als unzustellbar zurückgesendet, da wohl zumindest eine Postleitzahl fehlte. Für die Pendragon-Anwälte war der Fall damit klar: Porsche habe nicht genug dafür getan, um die Adresse des Fonds auf den Cayman-Inseln herauszufinden. Die Klageschrift sei daher nie bei Pendragon eingetroffen, die Feststellungsklage nie zugestellt und somit auch nicht erhoben worden.
Die Porsche-Anwälte argumentierten daraufhin, dass die Adresse aus dem Firmenregister der Cayman Islands stamme. Außerdem sei die Adresse in einem bekannten Gebäude zu verorten, in dem 19.000 der insgesamt rund 100.000 auf den Cayman-Inseln registrierten Unternehmen Briefkästen haben. Im Übrigen, so die Anwälte des Autobauers, sei die Klageschrift auch an die Anwälte Pendragons in Großbritannien versendet worden.
Den Torpedo konnten die Pendragon-Anwälte am Ende nicht mehr aufhalten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Zuständigkeit des Landgerichts Stuttgart mittlerweile bestätigt.