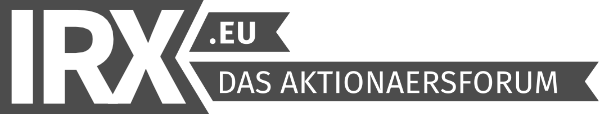Verschärfte Kapitalauflagen, schwaches Bond-Geschäft, politischer Gegenwind – das sind nur die wichtigsten Hürden, die sich den Bankern derzeit in den Weg stellen. Im Vergleich der Deutschen Bank mit ihren wichtigsten Konkurrenten in Europa und den USA zeigt sich:
Um diese Hürden zu überspringen, hatten alle Investmentbanken nach der Finanzkrise zunächst versucht, wieder zu alter Größe aufzuschließen; zurück zu Glanz und Gloria des Jahres 2009.
Billiges Geld der Notenbanken, konjunkturelle Anschubprogramme und brummende Börsen halfen ihnendabei. Doch mittlerweile rollt die große Wende, und wieder getrieben vom äußeren Anstoß.
Die Reformen der Finanzmärkte haben konkrete Formen angenommen. Selbst weitergehende Regulierungen, etwa zusammengefasst in dem Maßnahmenkatalog namens ‚Basel III‘, sind unterwegs. Und zuletzt hat auch das Börsengeschäft die Bankmanager zum Handeln getrieben: Das Anleihegeschäft ist in schwere Turbulenzen geraten.
In den vergangenen zwei Jahren hat es deshalb einigen im Topmanagment der großen Investmentbanken wohl gedämmert, dass die besten Zeiten zumindest vorerst vorbei sind. Jetzt steht nicht mehr das Streben nach Größe im Vordergrund, sondern der Kampf gegen Kosten und für mehr Profitabilität. Und die Deutsche Bank ist Teil dieser laufenden Auf-und-Ab-Entwicklung
Das prominenteste hiesige Geldhaus hat seine Bilanzsumme in den Jahren von 2009 bis 2011 zunächst um 44 Prozent auf 2,16 Billionen Euro ausgebaut, schrumpfte sie aber seitdem um ein Viertel auf 1,61 Billionen Euro bis Ende 2013 zurecht; immernoch eine gewaltige Zahl – sie entspricht übrigens 64,4 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
Zum Vergleich: JP Morgan Chase, die größte US-Investmentbank, baute ihre Aktiva seit 2009 kontinuierlich um insgesamt 20,2 Prozent auf 2,44 Billionen Dollar Ende 2013 aus. Schrumpfkurs bisher? Fehlanzeige.
Auch die US-Bank Morgan Stanley wuchs in jedem Jahr außer 2011, und arbeitet jetzt mit einer Bilanzsumme, die 8 Prozent über dem Volumen des Vorkrisenjahres 2008 liegt.
Anders dagegen bei Goldman Sachs: Das Bankhaus stockte in den zwei Jahren nach der Finanzkrise seine Bilanzsumme zwar um 10,6 Prozent auf, legte aber seit 2012 vorsichtig den Rückwärtsgang ein, auf jetzt 911,5 Milliarden Dollar. Das Vorbild dafür kommt aus Europa.
Kräftig abgespeckt hat etwa die Schweizer UBS, die bis 2011 zunächst um 6 Prozent auf 1,42 Billionen Schweizer Franken weiter zulegte, seitdem aber mit Minus 29 Prozent eine drastische Bilanz-Diät verordnet bekam.
Überhaupt, die Eidgenossen: Auch die Credit Suisse wuchs in den zwei Jahren bis 2011 um 1,9 Prozent, schrumpfte aber ihre Bilanzsumme seitdem um 17 Prozent auf 872,8 Milliarden Franken.
Mit der jüngsten Magerkur in einem Teil der Branche ist das Reizthema ‚Too Big to Fail‘ jedoch längst nicht abgehakt. Politiker, Akademiker und Regulierer warnen, dass die Bilanzen noch deutlich weiter schrumpfen, oder zumindest die Kapitalpolster aufgestockt werden müssen.
Die US-Bankenkritikerin Elizabeth Warren etwa, eine Demokratische Senatorin im Bankenausschuss, drängte Ende des Jahres 2013 die Marktaufseher, endlich die Finanzmarktreform ‚Dodd-Frank‘ schneller umzusetzen:
„Wenn Dodd-Frank den Regulierern ein Werkzeug in die Hand gibt um ‚Too Big to Fail‘ zu beenden, dann muss das auch genutzt werden. Aber wenn die Marktaufseher ihre Hausaufgaben nicht machen, muss eben der Kongress wieder ran.“
Warrens Fazit der bald sechs Jahre seit der Finanzkrise: „Die größten Banken sind größer denn je, das Risiko für das System hat zugenommen und die Verzerrungen im Markt halten an.“ Alle großen Wall-Street-Banken außer der Citigroup sind seit 2006 größer geworden.
Vor wenigen Tagen stimmte ihr Mark Carney zu, der Gouverneur der Bank of England und Vorsitzender des wichtigen Financial Stability Board: „Die Banken und Märkte beginnen, sich der Entschiedenheit der Regulierer zu beugen und ‚Too Big to Fail‘ zu beenden. Aber das Problem ist noch nicht gelöst.“
Auch im aufgeblähten britischen Bankensektor, dessen kollektive Bilanzsumme fünf Mal so groß ist wie das jährliche Bruttoinlandsprodukt der Inselwirtschaft, herrscht Unzufriedenheit mit den Fortschritten.
Ed Miliband, Chef der Labour-Party und Oppositionschef im Parlament, hält die fünf größten Banken des Landes für „zu einflussreich“ und möchte sie bei einem Regierungswechsel zwingen, eine „signifikante Zahl“ von Geschäftsstellen zu schließen.
Die Reaktionen auf den wachsenden Gegenwind bleiben bei den Banken nicht aus. Die Deutsche Bank etwa hat im März angekündigt, noch einmal 500 Jobs im Investmentbanking zu streichen.
Barclays, Großbritanniens zweitgrößte Bank, gab erst vor wenigen Tagen bekannt, in den nächsten drei Jahren 19.000 Stellen abzubauen. Bis zum Jahr 2016 müssen in London und New York 7000 von 26.000 Investment-Bankern gehen; das ist schlicht und ergreifend ein Rückzug aus dem schwierig gewordenen Geschäft.
Heute meldet Goldman Sachs die Überlegung des Hauses, mit dem Metallhandel einen ganzen Bereich des Investmentbankings zum Verkauf zu stellen. Und der Druck auf die Banken hat zuletzt insgesamt zugenommen.
Europas Investment-Banker erlebten im Januar den schlechtesten Auftaktmonat seit zehn Jahren. Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie mit Krediten und Wertpapier-Emissionen für Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ging im Jahresvergleich laut der New Yorker Research-Firma Freeman & Co. Um 22 Prozent zurück.
Die Stagnation in der Eurozone, neue Turbulenzen in den Schwellenmärkten und schwächere Anleiheverkäufe sorgen für miese Stimmung. Mit Blick auf die Stellenpläne der Investmentbanken in Europa sieht der Analyst Chirantan Barua bei Sanford Bernstein dicke Überkapazitäten in Höhe von 20 Prozent.
Die Probleme im Anleihegeschäft sieht Barua als strukturell an: „Jeder tanzt um das Problem herum“, sagt er, „nur die UBS hat ein Beil an die Bilanz angelegt, alle anderen warten, dass sich der Markt bald erholt, und halten dafür die Kapazitäten bereit.“
Bei den Investmentbanken selbst sieht man das freilich anders: „Wir erwarten, dass das Anleihegeschäft nach einigen Anpassungen gut sein wird, vieles an der aktuellen Entwicklung ist zyklisch“, erklärt JP-Morgan-Chef Jamie Dimon.
Wie auch immer.
Die nahe Zukunft der Investmentbanken wird stark davon abhängen, wer in diesem Punkt Recht behält. Die US-Banken profitieren in diesen mageren Zeiten von ihren relativ großen Aktiva, weil sie während der Durststrecke größere Kapazitäten vorhalten können.
Auch in diesem Lichte könnte man die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank sehen.